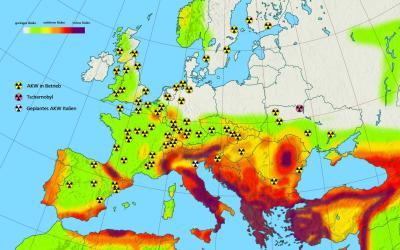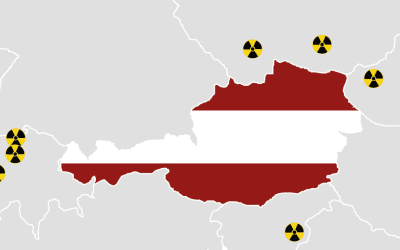Pfadnavigation
Österreich sucht ein Endlager für radioaktive Abfälle
Wo soll radioaktiver Abfall aus Medizin und Forschung in Österreich gelagert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die aktuelle Nationale Entsorgungsstrategie für österreichischen Atommüll.
Am Freitag, den 13. April 2018 legte das Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus die Nationale Entsorgungsstrategie und den Umweltbericht für den österreichischen Atommüllexternal link, opens in a new tab vor. Gleichzeitig beginnt die Strategische Umweltprüfung (SUP), die laut Ministerium Umwelterwägungen bei der Planung entsprechend berücksichtigen und die Öffentlichkeit ausreichend informieren soll. Ziel des Nationalen Entsorgungsprogramms ist die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung radioaktiven Abfalls (aus Industrie, Medizin und Forschung).
Entwurfs des Nationalen Entsorgungsprogramms:
Das vorliegende Programm macht keine konkreten Angaben, sondern kündigt eine Arbeitsgruppe an, die auch die Bevölkerung informieren soll:
„Im Hinblick auf die endgültige Entsorgung des radioaktiven Abfalls richtet die österreichische Bundesregierung eine Arbeitsgruppe „Entsorgung“, bestehend aus Ministeriumsvertretern, Ländervertretern, Fachexperten und Stakeholdern ein, welche Fragestellungen und Aufgaben nach den Grundsätzen des § 36b Strahlenschutzgesetz in effizienter und transparenter Weise abarbeiten wird … Dabei soll auch sichergestellt werden, dass die Bürgerinnen und Bürger Zugang zu allen relevanten Informationen haben und sich effektiv an der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit der Entsorgung des radioaktiven Abfalls beteiligen können.“
Die Republik Österreich trägt die Letztverantwortung für die sichere Entsorgung radioaktiver Abfälle. Es handelt sich um die Umsetzung der EURATOM-Richtlinie 70/2011, das nun vorliegende Entsorgungsprogramm hätte bereits im August 2016 fertig werden sollen. Nun beginnt dafür die Strategische Umweltprüfung (SUP) in Österreich, auch in potentiell betroffenen (Nachbar)Ländern wird eine SUP angekündigt. Der Entwurf des Nationalen Entsorgungsprogramms stellt gleich zu Beginn klar, dass eine Lösung außerhalb Österreichs willkommen wäre, d.h. der Export und die Endlagerung der radioaktiven Abfälle im Rahmen eines „internationalen“ oder „regionalen“ Endlagers. Mit diesem Bestreben nach einer auf den ersten Blick sinnvollen Lösung angesichts geringerer und nur nieder- und mittelaktiver Abfälle steht Österreich keineswegs alleine dar - die relevante EURATOM-Richtlinie 70/2011 sieht die Möglichkeit vor und kann daher die Mitgliedsstaaten an dieser Option nicht hindern, gleichzeitig ist klar, dass diese Option sehr unrealistisch ist. Nur kurz zu den Hauptproblemen:
- Welches Land würde den Import und die Lagerung von radioaktiven Abfällen seiner Bevölkerung erklären können?
- Dazu zählen Haftungsfragen: Wer zahlt, wenn sich die zunächst machbare technische Lösung innerhalb weniger Jahrzehnte als nicht sicher herausstellt und entweder Nachrüstungen oder gar Rückführungen zum Verursacher als notwendig herausstellen sollten?
Nicht einmal am Papier erscheint die gemeinsame Endlagerlösung als realistisch. Die in diese Richtung gestarteten EU-Projekte (SAPPIER) sind ausgelaufen und wurden von der EU-Mitgliedsstaaten-Arbeitsgruppe ERDO abgelöst. Diese steht nach wenigen Jahren nun selbst vor der Auflösung, weil schlicht nichts weitergeht und nur mehr fünf EU-Mitgliedstaaten (Österreich, Dänemark, Italien, Niederlande, Polen, Slowenien) beteiligt sind, wie eine jüngste Untersuchung unter Federführung des Österreichischen Ökologieinstituts (ÖÖ) ergeben hat.
Atommüll-Zwischenlager Seibersdorf (NÖ)
Laut Nationalem Entsorgungsprogramm ist aktuell die Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH (NES) mit der Behandlung des in Österreich anfallenden radioaktiven Abfalls beauftragt. Dieser Auftrag umfasst die Sammlung, Sortierung, Aufbereitung, Konditionierung sowie die längerfristige Zwischenlagerung des radioaktiven Abfalls am Standort Seibersdorf. Bis eine Entscheidung über die endgültige Entsorgung getroffen wird, wird angesichts des niedrigen Gefährdungspotentials - mehr als 95% schwach radioaktiver Abfall - die Zwischenlagerung bei NES in Seibersdorf durchgeführt. Die Abfallaufbereitung und -zwischenlagerung in Seibersdorf ist derzeit vorerst bis 2045 vertraglich abgesichert. Eine gut aufgegliederte Darstellung des Aufkommens und der Menge bzw. Herkunft der Atomabfälle in Österreich findet sich im nun vorgelegten Entwurf der Entsorgungsstrategie.
Zum weltweit ungelösten Thema der Endlagerung ist nun folgendes vorgesehen:
„Um dieses Ziel zu erreichen, muss dafür ein Entscheidungsprozess definiert werden. Neben der Klärung der rechtlichen und organisatorischen Fragen ist dabei vor allem sicherzustellen, dass das gesamte Verfahren völlig transparent abläuft. Alle wichtigen Entscheidungen müssen unter angemessener Einbindung der Öffentlichkeit und aller interessierten Institutionen stattfinden. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass ein komplexes mehrstufiges Verfahren zu durchlaufen sein wird.“
Eher allgemein fällt die Strategie aus, wenn es um den Kern der Sache geht. Die Arbeitsgruppe wird vor allem beauftragt ein Konzept für die umfassende Information und Einbindung der Öffentlichkeit zu erstellen. Um genügend Zeit für den Bau und die Inbetriebnahme der Anlage(n) für die Endlagerung zu gewährleisten, soll die Entscheidung über die endgültige Entsorgung des radioaktiven Abfalls spätestens 10 - 15 Jahre vor dem vertraglichen Ende der Zwischenlagerung fallen.
Dazu gibt es folgende Skizze:

Diese Skizze (Anhang 1 des Entsorgungsprogramms) zeigt, dass mit einer Entscheidung für 2030 gerechnet wird, danach folgt die Auswahl der Standorte, Verengung auf zwei Standorte mit der erstmaligen Einbindung der Öffentlichkeit. Dann sind noch Genehmigungsverfahren vorgesehen und die Errichtung selbst. Für alle diese Aufgaben sind 10 - 15 Jahre zu wenig, denn im radioaktivitätskritischen Österreich wird sich nur sehr schwer eine Gemeinde / Region finden, die freiwillig Atommüll übernimmt. Diese Aufgabe dauert wesentlich länger, ein Blick über die Grenze zur Orientierung: Die Tschechische Republik sucht mit Hochdruck seit dem Jahr 2000 ein Endlager und trifft bisher auf allen Kandidatenstandorten auf starken Widerstand. Einer der Gründe dafür ist ein schlecht vorbereitetes Auswahlverfahren mit unklaren Regeln, wandernden Zeitplänen und ungenügender Beteiligung der Öffentlichkeit sowie mangelhaft vorbereiteten gesetzlichen Grundlagen.
Was ist ein Endlager für schwach - und mittelaktiven Abfall?
Ein solches Endlager muss mindestens 300 Jahre sicher sein. Im Gegensatz zu Endlager für abgebrannten Brennstäbe aus Atomkraftwerken und anderen hochradioaktiven Abfällen, die es in Österreich nicht gibt – die aus dem „Prater-Reaktor“ werden in die USA zurück verfrachtet – wird meist kein Tiefenlager, sondern ein oberflächennahes Endlager errichtet:
„In Österreich fallen keine hochaktiven Abfälle mit langer Halbwertszeit an. Für den Großteil der in Österreich anfallenden radioaktiven Abfälle beträgt die Dauer der Lagerung rund 300 Jahre und ihre Aktivität ist zu 95% schwachaktiv. Der Aufwand einer Untertagedeponie erscheint daher nicht notwendig.“ (ÖÖ 2010)
Geologische Aspekte der Standortsuche
Die niederösterreichische Gemeinde Seibersdorf, derzeitiger Standort des österreichischen Zwischenlagers bis 2045, möchte nicht Endlagerstandort werden. Der Frage nach geologisch geeigneten Regionen in Österreich ist man schon zu Zeiten des geplanten AKWs Zwentendorf nachgegangen. Das Positionspapier des Österreichischen Ökologieinstituts (ÖÖ 2010) hält dazu fest:
„Noch heute relevant sind eventuell die Resultate zu den geologischen Grundlagen und Standortfragen (ELA 1981—1984). [...]1988 erhielt das Forschungszentrum Seibersdorf (ÖFZS) den Auftrag, ein Konzept zur Endlagerung der im ÖFZS gelagerten LILW zu realisieren (ELA 1998—1990). Es wurden 16 Standortbereiche genannt, bei denen es geologisch sinnvoll erschien, weiterzuarbeiten. Allerdings waren die 16 Standortbereiche genau jene, die in der Endlagerstudie als geologisches Tiefenlager für die Brennstäbe des KKW Zwentendorf ausgewählt wurden. Als Ergebnis dieser Untersuchungen wurde folgendes festgestellt: Ein Großteil der radioaktiven Abfälle aus Industrie, Medizin und Forschung könnte in einem oberflächennahen Lager untergebracht werden, da keine hohe Aktivität der Stoffe vorliege und die nötige Einschlusszeit 300 Jahre betrage. Nur die Uran-, Thorium- und Radium-haltigen Abfälle wären wegen ihrer höheren Radiotoxizität länger (1.000 Jahre Einschlusszeit) zu lagern. Damals wurde davon ausgegangen, dass ein unterirdisches Lager gebaut werden sollte.“
Was bisher geschah
Das Thema ist natürlich sehr heikel, diverse Regierungen und Umweltminister haben es immer wieder verschoben und vertagt. Bereits am 4. Juli 1991 wurde ein Unterausschuss des Gesundheitsausschusses zur Klärung der Fragen um das österreichische Endlager für den Atommüll eingesetzt, erste Ambitionen im Waldviertel und Weinviertel führten zu radikalen Protesten und wurden wieder eingestellt. 1994 gab es einen Entschließungsantrag zur Frage der Endlagerung - doch nichts geschah. Auch weiterhin hatte die Regierung keine Lösung für Österreichs Atommüll aus Forschung und Medizin.
Erst die EURATOM-Richtlinie 2011/70 führte dazu, dass Österreich den notwendigen Prozess startete. Denn laut dieser Richtlinie müssen alle EU-Mitgliedsstaaten bis 23. August 2015 die Inhalte ihres Nationalen Programms zur Umsetzung der Politik für die Entsorgung abgebrannter Brennstäbe und radioaktiver Abfälle in Brüssel vorlegen. Davor soll es laut Vorgabe eine Strategische Umweltprüfung (SUP) unter Beteiligung der Öffentlichkeit geben. Als eines der letzten EU-Länder und nach einer Mahnung der EU-Kommission war es im Frühjahr 2018 soweit – der Startschuss wurde gegeben.
Referenzen
- ÖÖ 2010 Positionspapier zur Lagerung des österreichischen radioaktiven Abfalls von Antonia Wenisch, Wolfgang Konrad, Gabriele Mraz, Andrea Wallner. Wien 2010.external link, opens in a new tab
- Nationale Entsorgungsstrategie 2018external link, opens in a new tab
GLOBAL 2000 Stellungnahme: